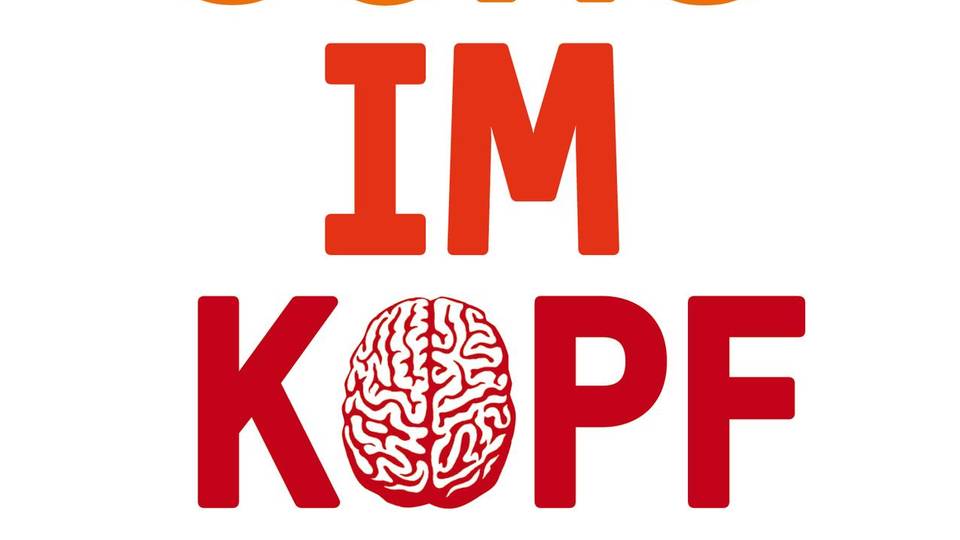Manchmal ist es gar nicht so einfach, eine Entscheidung zu treffen. Woran das liegt und in welchen Situationen einiges dafür spricht, wichtige Entscheidungen aufzuschieben, hat uns der Hirnforscher Professor Doktor Martin Korte verraten.
Entscheidungen. In dem einen Moment treffen wir die kniffligste, wegweisendste Lebensentscheidung mit größtmöglicher Klarheit und gutem Gefühl und in anderen Momenten können wir nicht einmal sagen, was wir zu Abend essen möchten. Wie kann das sein? Wieso sind wir manchmal entschlusskräftig und mit dem absoluten Durchblick gesegnet und manchmal von den simpelsten Fragestellungen überfordert? Darüber habe ich mit dem Hirnforscher Professor Doktor Martin Korte gesprochen.
Bewusste und unbewusste Entscheidungen
Tatsächlich treffen wir in unserem Alltag zahlreiche Entscheidungen, ohne dass wir davon sonderlich viel mitbekommen. Kaffee kochen, nachdem wir aufgestanden sind, Nachrichten beantworten, die mit einem Fragezeichen enden, rechtzeitig zur Seite springen, wenn zwei spielende Hunde auf uns zu gerast kommen. In solchen Fällen weist uns unsere Intuition meist zuverlässig den Weg, während unsere Gedanken auf etwas anderes gerichtet sein können.
Unsere Intuition eignet sich prima für Entscheidungen in Situationen, in denen wir entweder sehr schnell sein müssen oder die sich, in ähnlicher Ausführung, in unserem Leben häufig wiederholen oder beides. Intuitiv getroffene Entscheidungen kosten unser Gehirn vergleichsweise wenig Energie, da hierfür eher sparsame und ursprüngliche Regionen zum Einsatz kommen, etwa die sogenannten Basalganglien. Wir entscheiden dann in erster Linie routiniert, das heißt basierend auf unseren Erfahrungen gemäß einem uns bekannten und erprobten Muster.
Befinden wir uns hingegen in einer für uns neuartigen Situation und/ oder können eine Entscheidung treffen, in der wir gerne unterschiedliche Optionen gegeneinander abwägen möchten oder gezielt nach Informationen suchen, die die Qualität unserer Entscheidung verbessern können, dann ist das laut Martin Korte ein Fall für unseren Stirnlappen. Diese Hirnregion hat sich im Laufe der Menschheitsgeschichte verhältnismäßig spät entwickelt und ist in ihrer Ausprägung und Beschaffenheit der menschlichen Spezies eigen. Ob eine Pro- und Kontra-Liste erstellen, “Was wäre, wenn …”-Szenarien durchspielen oder die Konsequenzen einer Handlung bis morgen, übermorgen und in 30 Jahren beleuchten, all das ist uns dank unseres Stirnlappens möglich – deshalb können wir theoretisch klügere Entscheidungen treffen als beispielsweise eine Giraffe oder ein Einsiedlerkrebs.
Außerdem ist unser Stirnlappen für das zuständig, was wir gemeinhin Willenskraft nennen. Das heißt, wenn wir etwa die Wahl zwischen einer verführerischen, bequemen Option haben und einer, die uns zwar Überwindung kostet, sich letzten Endes aber auszahlt, können wir uns für Letztere vor allem mithilfe unseres Stirnlappens entscheiden. Ziemlich praktisch. Doch es gibt einen Haken: Die Funktionen unseres Stirnlappens stehen uns nicht jederzeit vollumfänglich oder gar unbegrenzt zur Verfügung.
Darum fallen uns bewusste Entscheidungen manchmal so schwer
“Wann immer wir eine bewusste Entscheidung treffen, also eine, bei der unser Stirnlappen involviert ist, sind Nervenzellen aktiv, die Energie brauchen, selbst aber keine Energie speichern”, sagt Martin Korte. “Deshalb kann unser Stirnlappen bei Beanspruchung ermüden, ähnlich wie ein Muskel.” Im Vergleich zu anderen Teilen unseres Gehirns benötigt diese Hirnregion zudem besonders viel Energie, um einwandfrei zu arbeiten. “Unser Stirnlappen hat zahlreiche synaptische Verbindungen in andere Netzwerke und muss sehr viele Informationen miteinander verknüpfen, daher ist er besonders energieintensiv”, sagt der Neurobiologe.
Befinden wir uns nun in einer Situation, in der wir mit einem ermüdeten Stirnlappen eine bewusste, also energieintensive Entscheidung treffen möchten, steht uns nur ein Bruchteil der Nervenzellen für diese Aufgabe zur Verfügung, die wir mit ausgeruhtem Stirnlappen oder “voller Rechenkapazität” nutzen könnten. Dadurch erscheint uns die Entscheidungsfindung in solchen Fällen wahnsinnig schwer – und unter Umständen wird die Qualität unserer Entscheidung leiden. Statt dem vollen Programm von Pro-Kontra-Liste bis 30-Jahre-Konsequenzen-Szenario schafft unser Stirnlappen womöglich nämlich gerade noch die Frage “was wäre, wenn …” mit “mir doch egal” zu beantworten. Und das mag vielleicht nicht einmal stimmen.
Aus diesem Grund kann es in einigen Momenten tatsächlich besser sein, eine Entscheidung aufzuschieben oder abzugeben, anstatt uns damit abzuquälen – denn einen ermüdeten Stirnlappen bekommen wir nicht so ohne Weiteres von einer Sekunde auf die andere wieder fit. In folgenden Situationen ist unser Stirnlappen typischerweise nicht in seinem leistungsfähigsten Zustand, sodass unser Urteils- und Entscheidungsvermögen beeinträchtigt sein kann.
5 Momente, in denen es tatsächlich besser sein kann, keine Entscheidung zu treffen
1. Am Abend
Nach einem Tag voller Entscheidungen und Herausforderungen ist unser Stirnlappen in der Regel ausgelaugt und weniger fit als am Morgen oder zu unserem persönlichen Tageshöhepunkt. Deshalb haben wir uns abends tendenziell weniger unter Kontrolle als tagsüber. “Die meisten Menschen, die sich ausgewogener ernähren wollen, fangen morgens gesund an und sitzen abends doch oft mit der Chipstüte auf der Couch”, sagt Martin Korte. “Das hat etwas mit einem Ermüden unseres Stirnlappens zu tun beziehungsweise der Nervenzellen, die unsere langfristigen Ziele codieren. Die sind besonders energieintensiv und anfällig. Das heißt, es sind mit die ersten, die ausgeschaltet werden, wenn unsere Energie zur Neige geht.”
2. Bei Stress
Wenn wir gestresst sind, etwa weil wir sehr viel gleichzeitig um die Ohren haben oder weil uns eine größere Angelegenheit belastet, sei unsere Rechenkapazität dem Neurobiologen zufolge eingeschränkt, da ein Teil unseres Stirnlappens permanent mit unseren Problemen beschäftigt sei. Untersuchungen zufolge könne sogar der Intelligenzquotient bei Stress sinken. So habe eine Studie unter amerikanischen Farmer:innen ergeben, dass ihr IQ zu Beginn der Saison, nachdem sie gerade Unmengen an Geld für Maschinen, Saatgut und Co. ausgegeben haben, teilweise um bis zu zehn Punkte niedriger gelegen habe als nach der Ernte, so Martin Korte. Ähnliches lasse sich bei Menschen in herausfordernden Lebenssituationen beobachten, beispielsweise nach einem Jobverlust. “Nun ist es nicht so, dass diese Menschen dümmer geworden wären”, sagt der Hirnforscher. Durch ihren Stress stehen ihnen nur nicht all ihre Nervenzellen zur Verfügung.
3. Wenn wir uns schlecht fühlen
Sowohl bei Stress als auch bei anderen uns unangenehmen Emotionen wie Angst, Wut oder Trauer werden laut Martin Korte Nervenzellen in unserem Stirnlappen aktiv, um unsere Gefühle abzuwehren beziehungsweise ihre Wirkung zu dämpfen. Dieser Mechanismus kann uns vor unkontrollierten Gefühlsausbrüchen bewahren, kostet allerdings Energie. Von daher steht uns in Phasen der Trauer oder Angst sowie in Momenten, in denen wir wütend und aufgebracht sind, nur ein eingeschränkter Teil unserer Rechenkapazität für Entscheidungen bereit, weshalb es unter Umständen besser sein kann, ein wenig abzuwarten. Interessant: Bei positiven Emotionen wird diese Abwehrreaktion nicht ausgelöst, im Gegenteil erhöhen angenehme Gefühle unsere Rechenkapazität sogar.
4. Während einer Diät/ wenn wir Hunger haben
Bei einem niedrigen Glukosespiegel kommen zwei Faktoren zusammen: Wir fühlen uns schlecht, das heißt, unser Stirnlappen hat negative Emotionen zu bekämpfen, und aufgrund unseres niedrigen Energielevels können wir den hohen Energiebedarf der Nervenzellen in unserem Stirnlappen nicht decken. Tatsächlich zeigt die Statistik, dass Richter:innen vor ihrer Mittagspause tendenziell schlechtere Urteile fällen als danach.
5. Wenn wir körperlich krank sind
Wir mögen denken, fantasieren und fühlen, doch vor allen Dingen sind wir als Menschen körperliche Einheiten. Wird unsere Energie gebraucht, um Viren, Bakterien oder sonst etwas zu bekämpfen, bleibt nicht mehr genug für die anspruchsvollen Nervenzellen unseres Stirnlappens übrig, um aufwendige Entscheidungen zu treffen.
Nicht für jede Entscheidung brauchen wir 100 Prozent
Selbst wenn wir intuitive Entscheidungen außen vor lassen und nur die bewussten berücksichtigen, sind es an den meisten Tagen sehr, sehr viele, die wir zu treffen haben. Wir können und müssen nicht jede dieser Entscheidungen bei voller Kapazität und mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit treffen. Einerseits können wir nämlich selbst in unserer Bestform niemals alle Informationen und Details eines Zusammenhangs erfassen, ein gewisser Mut zur Lücke ist also in jedem Fall erforderlich. Andererseits kommt es in vielen Momenten gar nicht so genau darauf an, welche Entscheidung wir treffen, weil die unterschiedlichen Optionen letztlich alle den gleichen Wert haben. Sie mögen verschiedene Konsequenzen mit sich bringen und uns mehr oder weniger Scherereien verursachen, doch mit jeder getroffenen Entscheidung erschaffen wir ein Stück Realität und am Ende zählt vor allem, was wir mit dieser Realität anfangen.
Dennoch kann es sich manchmal richtiger für uns anfühlen, mit einer Entscheidung zu warten, bis unser Stirnlappen ausgeruht und voll funktionsfähig ist, denn in gewisser Weise sind wir dann am ehesten wir selbst und haben die größtmögliche Kontrolle über unser Handeln, die wir erreichen können. Es mag in den meisten Fällen keine große Rolle spielen, welche Entscheidung wir treffen – doch eine Entscheidung zu treffen und hinterher das Gefühl zu haben, sie gar nicht wirklich selbst bewusst gewählt zu haben, kann mitunter sehr schmerzhaft sein. Und das würde dann wiederum unseren Stirnlappen belasten.

Professor Doktor Martin Korte ist Neurobiologe und Leiter der Abteilung “Zelluläre Neurobiologie” an der Technischen Universität Braunschweig. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem zelluläre Grundlagen von Lernen und Gedächtnis sowie Wechselwirkung zwischen Immunsystem und Gehirn bei der Entstehung der Alzheimer Erkrankung. In seinen Büchern “Hirngeflüster“, “Wir sind Gedächtnis“ und “Jung im Kopf“ bereitet er Erkenntnisse aus der Hirnforschung alltagsrelevant und für ein breites Publikum auf. Fernsehzuschauer:innen kennen Martin Korte vielleicht aus der RTL-Quizshow mit Günther Jauch “Bin ich schlauer als …”, für die er die Fragen entwickelte.
Source: Aktue