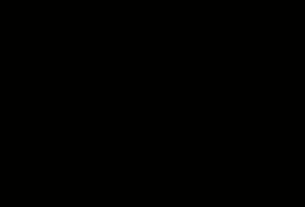Erinnerungen, Interpretationen, Gewohnheiten – in unser Fühlen fließen zahlreiche Faktoren ein, die uns kaum bewusst sind. Einer dieser Faktoren sind unsere Erwartungen.
Ob wir wollen oder nicht, in unsere Interpretationen und Einordnungen unserer Wahrnehmungen fließen in den meisten Fällen Erwartungen mit ein. Erwartungen, Ansprüche und Vorstellungen davon, wie die Dinge sein müssten. Ob diese Erwartungen uns Ziele und Orientierung bieten, ob sie uns erleichtern und dabei helfen, die Welt zu ordnen, oder wozu oder warum auch immer sie da sind – sie sind es, und zwar vielfach, ohne dass es uns bewusst ist. Kein Problem. Allerdings hat es eine Auswirkung darauf, wie und was wir fühlen. Das wiederum kann besonders dann interessant (für uns) werden, wenn unsere Vorstellungen nicht zur Realität passen. Vier Beispiele.
4 Erwartungen, die deine Gefühle beeinflussen können, ohne dass du es merkst
1. Das Leben muss schön sein.
Das Leben muss schön sein, ich muss überwiegend glücklich oder zufrieden sein, ich muss weitestgehend gerne leben und am liebsten uralt werden. Solche Vorstellungen begleiten viele Menschen wie selbstverständlich von ihrer Jugend bis ins höhere Erwachsenenalter und darüber hinaus. Das ist sicherlich nicht völlig verkehrt oder schlecht: Positive Vorstellungen wie diese können uns motivieren und Hoffnung schenken, können unseren Lebenswillen stärken und erhalten. Allerdings gibt es keine Belege dafür, dass diese Vorstellungen wahr sind. Im Gegenteil: Die Realität legt eher nahe, dass sie es nicht sind.
Krankheit, Verlust, Existenznot, Überforderung, Einsamkeit, Schmerz. Es ist zwar nicht ganz klar, was Konzepte wie “schön” und “glücklich” genau umfassen, doch an solche Dinge würden vermutlich die wenigsten Leute denken, wenn die Begriffe fallen – dabei gehören diese Elemente genauso zum Leben dazu wie Liebe, Genuss, Freude und Wohlbefinden. “Das Leben muss schön sein”, kann offenbar also nicht stimmen.
Für uns bedeutet das: Wir durchleben unweigerlich Zeiten, die wir nur mit sehr viel Mühe als schön bezeichnen könnten. Wenn wir nun aber die Erwartung haben, das Leben müsste schön sein, kann das in solchen Zeiten Frust entstehen lassen und Druck aufbauen. Wir haben den Eindruck, es liefe etwas falsch. Unsere Erwartung wird uns dann erschweren, zu akzeptieren, was ist, wird uns vielleicht sogar erschweren, mit dem Schmerz, der Trauer, Sorge oder dem Stress, den wir aufgrund unserer Situation fühlen, angemessen umzugehen.
2. Menschen müssen gut sein.
Menschen haben ein Gewissen. Menschen müssen gut sein, im Notfall eine Arche bauen und alle Lebewesen retten, die existieren, ihre zweite Wange hinhalten und nicht immer nur an sich denken. Tendenziell erwarten wir viel von uns und unseren Mitmenschen. In der Vorstellung der meisten Personen ist der Mensch einem Gott näher und ähnlicher als einer Eidechse. Das hat zwar Vorteile: So werden wir uns, um unserem Bild zu entsprechen, eher bemühen, moralisch zu handeln, und können besser miteinander kooperieren, anstatt uns gegenseitig zu schaden und zu zerstören. Allerdings ist es nur bedingt wahr – insbesondere der Teil mit dem Gott und der Eidechse.
Wir können zwar im Internet surfen, unsere Gefühle benennen und bedenken sowie entscheiden, was für ein Mensch wir am liebsten sein möchten. Doch wir sind sterbliche Wesen mit begrenzten Mitteln und Fähigkeiten. Unsere Intelligenz ist beschränkt, unsere Bedürfnisse und Interessen haben einen großen Einfluss auf unser Handeln und laufen weitestgehend auf ein Hauptziel hinaus: Unser Leben (und gegebenenfalls das unserer Art) erhalten.
Wir können voneinander und von uns selbst durchaus erwarten, dass wir uns wie Menschen verhalten und nicht wie Eidechsen. Wenn wir aber glauben, dass Menschen immer nur gut sein müssten, wird es uns schwer fallen, all das zu akzeptieren, was wir in unserer Beschränktheit, unserem egoistischen Überlebensdrang und unserer Abhängigkeit von unserem Organismus fabrizieren. Es wird uns dazu verleiten, zu verurteilen und zu hassen, und uns dabei im Weg stehen, bedingungslos zu lieben und zu verzeihen.
3. Andere müssen mich mögen.
Es ist normal und verständlich, dass wir grundsätzlich gemocht werden möchten. Die Sympathie unserer Mitmenschen bestätigt uns, vermittelt uns positive Gefühle. Als soziale Wesen haben wir ein Interesse daran, von unseren Artgenossen angenommen zu werden. Allerdings ist es nicht selbstverständlich, dass andere Menschen uns mögen – wir selbst mögen schließlich wahrscheinlich nicht jede Person, die uns begegnet.
Die Grunderwartung, gemocht werden zu müssen, kann dazu führen, dass wir uns verletzt, angegriffen und beleidigt fühlen, sobald uns jemand nicht mag. Wir suchen nach Gründen, zweifeln an uns selbst oder an der Person, unterstellen ihr möglicherweise böse Absichten, die gar nicht bestehen. Wenn wir mit dieser Grunderwartung durch unser Leben gehen, lenkt das unseren Fokus generell auf die Menschen, die uns nicht mögen, anstatt auf die, die uns mögen.
4. Alles muss einen Sinn haben.
Die meisten Menschen tun sich sehr viel leichter, Dinge zu akzeptieren, wenn sie einen Sinn darin sehen. Es muss Gründe dafür geben, dass alles so ist, wie es ist. Sonst könnte doch zum Beispiel jeden Tag die Sonne scheinen, während es in der Nacht regnet. Oder jede Person würde friedlich einschlafen, wenn ihre Zeit gekommen ist. Es ist ja okay, dass wir nicht für alles die Gründe kennen – aber geben muss es welche, denn alles hat einen Sinn.
Daran zu glauben, ist grundsätzlich völlig okay und tut vermutlich den wenigsten weh – solange der Glaube stark genug ist. Allerdings kann es befreiend sein und sich positiv auf das Lebensgefühl auswirken, nicht von einer prinzipiellen Sinnhaftigkeit auszugehen. Denn wäre beispielsweise das Leben nicht ein beeindruckendes Wunder, wenn es keinen Sinn hätte? Wenn es keinen Sinn bräuchte, um uns und all die anderen Lebewesen seit Jahrtausenden dazu zu bringen, es immer weiter fortzusetzen und es zu verteidigen? Wäre es nicht eine Erleichterung, wenn die Dinge wären, wie sie sind – und das genug wäre? Ohne den Glauben an einen Sinn müssten wir zwar eine Suche aufgeben, die seit Generationen für viele Menschen wichtig ist. Aber wer sagt, dass wir dann nichts mehr finden würden?
Source: Aktue